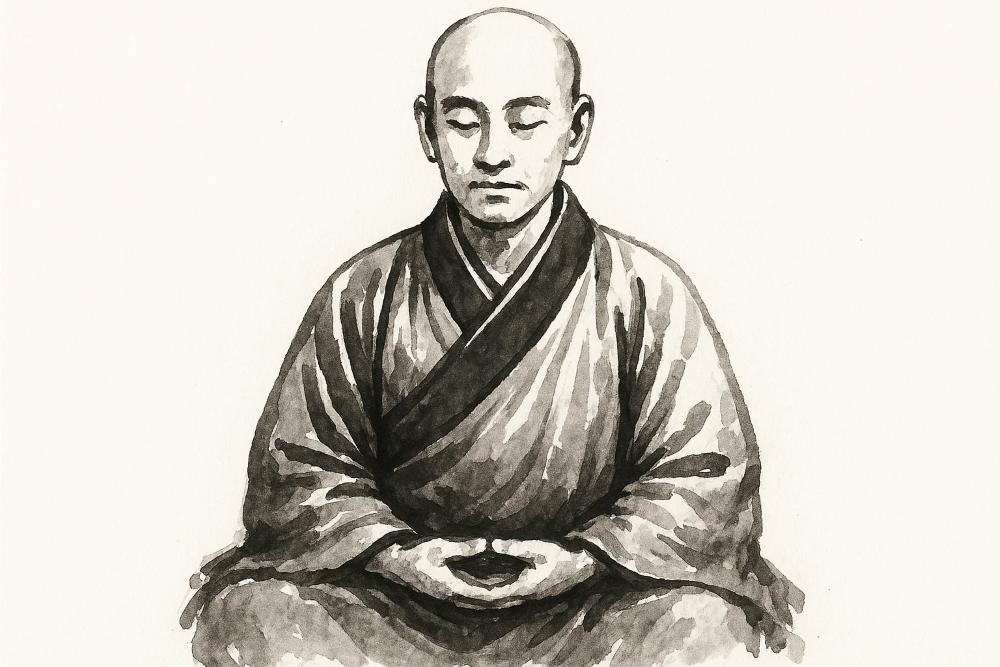
Die Bedeutung von Mujō im Zen-Buddhismus: Die Akzeptanz der Vergänglichkeit
Teilen
Das Wort kommt wie eine Brise, die durch eine Papiertrennwand huscht – sanft, fast nichts – und doch ordnet es den Raum neu. Mujō, japanisch für Vergänglichkeit, ist eine jener Ideen, die zu einfach erscheinen, um viel Gewicht zu tragen, bis man bemerkt, wie sehr sie sich durch ein Leben zieht. Es sind die Kirschblüten, die in eine Woche rücksichtsloser Schönheit explodieren und sich dann, unentschuldigt, in den Fluss ergießen. Es ist die zerbrochene Teeschale, die trotzdem Wärme ausgießt. Es ist das letzte Licht an einem Winternachmittag, das hinter einer Dachlinie verschwindet, während man nach seinen Schlüsseln sucht. Nichts steht still. Mujō ist kein Problem, das man lösen muss. Es ist der Zustand des Hierseins.
In den buddhistischen Wurzeln, die das japanische Denken nähren, ist Vergänglichkeit kein poetisches Beiwerk, sondern ein Axiom. Alles Zusammengesetzte – Körper, Gebäude, Stimmungen, Imperien – entsteht und vergeht. Das ist kein Pessimismus; es ist eine Diagnose. Leiden beginnt, wenn wir darauf bestehen, dass der Fluss sich wie Stein verhalten soll. Zen, das den größten Teil seiner Gelehrsamkeit gegen direkte Erfahrung eintauschte, schult den Körper, diese Lektion zu lernen, bevor der Geist Einwände erhebt. Setzen Sie sich auf ein Kissen und beobachten Sie, wie ein einzelner Atemzug ankommt, seinen Höhepunkt erreicht und vergeht. Versuchen Sie, ihn festzuhalten, und Sie enden mit einer Faust um Luft. Lassen Sie ihn sich bewegen, und Sie können die Intelligenz des Zyklus spüren: wie die Leere Raum für den nächsten Atemzug schafft, wie Loslassen kein Versagen, sondern ein Tor ist.
Mujō wird in der japanischen Vorstellungswelt oft mit zwei verwandten Begriffen in Verbindung gebracht: Wabi-Sabi, die Schönheit des Verwitterten und Unvollständigen, und Mono no Aware, der sanfte Schmerz, der mit der Erkenntnis der Vergänglichkeit einhergeht. Dies sind keine elitären Ästhetiken; sie sind Stützräder für das Herz. Ein Teemeister wählt eine Tasse nicht, weil sie makellos ist, sondern weil ihre Glasur ein kleines Universum von Zufällen birgt, eine Oberfläche, die das Licht in jeder Jahreszeit anders durchlässt. Es geht nicht darum, den Verfall zu vergöttern, sondern sich mit dem Wandel vertraut zu machen, zu erkennen, dass die Zeit nicht nur nimmt – sie offenbart. Ein Kratzer wird zu einer Geschichte, eine Reparatur zu einem Versprechen. Selbst Kintsugi, die Kunst, eine zerbrochene Schale mit Lack und Gold zu reparieren, ist weniger ein Trick als ein Bekenntnis: Wir bestehen aus Fugen, und die Fugen können glänzen.
Wäre Mujō nur eine Philosophie der Akzeptanz, könnte man sie leicht mit Resignation verwechseln. Das Gegenteil ist der Fall. Sobald man die Illusion der Dauerhaftigkeit fallen lässt, bleibt eine durch Achtsamkeit geschärfte Aufmerksamkeit. Die Dichter des Heian-Hofes wussten dies und schrieben mit wilder Zärtlichkeit über die Rundung eines Ärmels oder die Art und Weise, wie die Morgendämmerung einen Schirm verfärbt, gerade weil sie verstanden, dass sich diese Einzelheiten nicht wiederholen würden. Die Zärtlichkeit überlebt im modernen Leben, wenn man sie zulässt. Ein Elternteil, das einem Kind, das plötzlich aus dem Schuh herausgewachsen ist, die Schnürsenkel zubindet. Eine Krankenschwester, die in einer ruhigen Station ein Laken glättet. Ein Pendler, der sich mit dem Barista unterhält, der seine Bestellung kennt und wahrscheinlich diesen Sommer wegziehen wird. Mujō verlangt nicht, dass man sich von solchen Szenen distanziert, sondern dass man sich ganz auf sie einlässt, in dem Wissen, dass sie zeitlich begrenzt und daher kostbar sind.
Auch in dem Konzept steckt eine durchdringende politische Klarheit. Institutionen geben vor, unsterblich zu sein; Volkswirtschaften verkaufen die Illusion, dass das Wetter dieses Quartals ewig anhalten wird. Mujō durchlöchert diese Mythen und schärft dadurch die Verantwortung. Wenn eine Küstenlinie nicht garantiert ist, wie behandeln wir sie dann jetzt? Wenn eine Demokratie wie ein Lebewesen atmet, wie halten wir sie dann mit Sauerstoff versorgt? Das Bewusstsein, dass Dinge zerfallen können, ist keine Entschuldigung, mit den Achseln zu zucken; es ist ein Aufruf zur Verantwortung. Vergänglichkeit verleiht der Dringlichkeit ihre Ethik.
Im kleineren Maßstab entwaffnet Mujō den Perfektionismus. Der Geist möchte den Tag auf Distanz halten, bis er sicher, ordentlich und vorhersehbar wird. Die Vergänglichkeit weist darauf hin, dass der Tag bereits begonnen hat, halb vorbei ist, zu Ende geht – wählen Sie Ihr Verb – und dass die einzig sinnvolle Reaktion darin besteht, teilzunehmen. Ein Maler bringt Pigment auf die Leinwand, ohne auf eine Garantie zu warten. Ein Programmierer liefert Code aus, wohl wissend, dass er gepatcht werden wird. Man entschuldigt sich, solange es noch von Bedeutung ist. Der Mut zum Handeln kommt nicht aus der Gewissheit, sondern aus der Vertrautheit mit dem Wandel.
Unweigerlich tritt die Trauer ins Bild. Mujō verharmlost den Verlust nicht. Er weigert sich, darüber zu lügen. Die Erkenntnis, dass alles vergeht, löscht nicht die besondere Person aus, die aus Ihrem Leben verschwunden ist, oder den Job, oder die Version von sich selbst, von der Sie annahmen, dass Sie sie jetzt leben würden. Was sie stattdessen bietet, ist eine Möglichkeit, die Abwesenheit zu tragen: nicht als gefrorenes Denkmal, sondern als eine fortwährende Beziehung zu dem, was bleibt. Ein Parfüm in einem Schal. Eine Phrase, die Sie in ihrem Rhythmus sagen. Der Himmel um 17 Uhr in einem Monat, den sie liebten. Der Schmerz ist real. So ist auch die Dankbarkeit, die damit verflochten ist. Die Vergänglichkeit macht beides lesbar.
Die Praxis des Mujō erfordert keinen Tempel. Sie kann mit ganz gewöhnlichen Mitteln geübt werden. Bereiten Sie Tee zu und schmecken Sie ihn wirklich. Gehen Sie einen Ihnen bekannten Häuserblock entlang und achten Sie darauf, welches Haus Hortensien durch Rosmarin ersetzt hat, welches Fenster jetzt eine Kinderzeichnung eines Wals zeigt. Treten Sie nach dem Regen nach draußen und beobachten Sie, wie Dampf wie ein stilles Gebet vom Bürgersteig aufsteigt. Es geht nicht darum, ein Highlight-Reel der Achtsamkeit zu erstellen, sondern die Wahrnehmung so umzuschulen, dass Veränderung nicht mehr als Beleidigung ankommt, sondern als Kontext fungiert. Widerstand verwandelt sich in Rhythmus. Sie sind nicht mehr überrascht von der Flut.
Wenn es einen einzigen Satz gibt, der den Geist der Sache einfängt, dann ist es vielleicht dieser: Nichts ist von Dauer, und deshalb ist Liebe wichtig. Lieben bedeutet, der Veränderung zuzustimmen – Ja zu sagen zu dem, was ist, im Wissen, dass es nicht in dieser Form bleiben wird. Man lernt, eine Phase zu würdigen, ohne sie mit einem ganzen Leben zu verwechseln. Man lernt, ein Gespräch zu beenden, wenn es wirklich vorbei ist. Man lernt, immer wieder neu anzufangen, mit dem Geist eines Anfängers und der Bereitschaft, sich von dem, was man trifft, verändern zu lassen.
Das Wort gleitet so leicht zurück durch den Bildschirm, wie es gekommen ist. Nichts Dramatisches ist passiert, und doch alles. Der Raum ist derselbe, nur dass man jetzt sehen kann, wie sich das Licht über die Dielen bewegt, wie der eigene Atem ein- und ausgeht, als ob er durch eine Türöffnung ginge, wie die eigene Hand an der Türklinke eine ganze Biografie der Berührung enthält. Mujō hat nichts hinzugefügt; es hat die Illusion entfernt, dass die Dinge feststehen. Was übrig bleibt, ist klarer, praktikabler, seltsamerweise freundlicher. Man tritt in den Nachmittag, so wie er ist, unwiederholbar, und er empfängt einen genau einmal.






